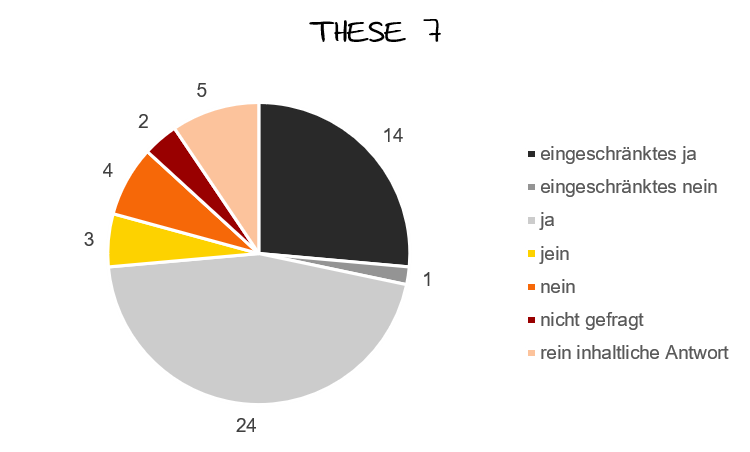Das Thema Gendern beschäftigt uns als Team immer wieder:
Wollen wir – oder wollen wir nicht?
Sollten wir – oder brauchen wir nicht?
Oder sollten wir sogar nicht?
Bislang hatten wir uns für diesen Blog gegen das Gendern entschieden.
Von Anfang an sind in unserem Team die Frauen in der Überzahl und auch bei unserer Mutter, dem CCMI, hatten wir von Beginn an ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern. Wir sind universitätsnah aufgestellt und „unsere“ Frauen sind zumeist Ingenieurinnen. Vielleicht erschien uns gendern deshalb überflüssig?
Nach dem Jahreswechsel kamen wir jedenfalls bei den kommunikationsrebellen wieder auf das Thema – wir forschen zu Kommunikation und Kommunikationskultur – sollte da nicht auch das Thema Gendern Beachtung finden? Dieses Mal war die Antwort „Ja“ – zumindest für unseren Blog. Mehr dazu am Ende des Textes.
Wir haben für die Entscheidung keine wissenschaftliche Untersuchung gestartet oder eine tiefe Expertise aufgebaut. Sondern haben uns gegenseitig unsere Gedanken und Haltungen geschildert – daran möchten wir hier teilhaben lassen. Wir würden uns übrigens freuen, wenn wir von Euch Eure Gedanken erfahren könnten – direkt hier, offen, im Blog oder gerne auch als private Nachricht an uns.
Theresa
Als Frau in einem eher männerlastigen beruflichen Umfeld fand ich Gendern immer eher etwas nervig, weil ich keine Sonderbehandlung wollte, generell nicht den Fokus auf mein Geschlecht sondern auf meine Leistungen legen wollte, ja nicht den Klischees entsprechen – und ich mich ja trotzdem angesprochen fühlte.
Diese Einstellung hat sich mittlerweile geändert und hört sich selbst in meinen Ohren etwas naiv an, weil ich festgestellt habe, dass meine Grundhaltung nicht von allen geteilt wird – und einige Personen sich aus anderen Gründen gegen das Gendern stellen.
Ich möchte, dass Sprache einladend und inkludierend wirkt – für alle Teilnehmer unserer Kommunikation. Und wenn ich sehe, dass das Thema ‚Gendern‘ gerade dermaßen politisiert und in dem Zusammenhang häufig lächerlich gemacht wird. Ein Beispiel: Ein Wahlspruch bei der Wahl zum Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt lautete „Machen statt Gendern!“ – als würde sich das widersprechen!!! (ein Danke geht an dieser Stelle raus an den Qualitätspodcast „Talk ohne Gast“). Dann kommt der Rebell in mir aber dermaßen zum Vorschein und ich komme in eine „Jetzt erst recht“-Haltung; weil ich unter keinen Umständen dieselben Argumente vorbringen möchte wie diese Personen. Also nehme ich den zusätzlichen Zeitaufwand von 2 Sekunden je Ansprache sehr gerne in Kauf, um eine sprachliche Inklusion zu fördern – denn das ist, was Gendern für mich bedeutet. Auch wenn es unsere Vielfalt nicht allumfassend widerspiegelt und die Umsetzung nicht allein bewirken kann, so kann es wenigstens sensibilieren und ein erster Schritt sein.
Ines
Ich tue mich mit dem Thema Gendern eher schwer und musste für unser Projekt und insbesondere diesen Artikel erst einmal herausfinden, warum das eigentlich so ist? Allein die Erkenntnis, dass in diesem Thema ein Konflikt für mich vorhanden ist, war schon spannend und hat mich auch überrascht.
Zu den positiven Aspekten
Die sprachliche Entwicklung, basierend auf einer Entwicklung der Gesellschaft die das Gendern mit sich bringt, ist für mich ein sehr positiver Aspekt, der sowohl unsere Anpassungsfähigkeit als auch eine gewisse gesellschaftliche Reflexion zeigt. Für mich ist diese gesellschaftliche Entwicklung, die sich mit dem Gendern in Sprache ausdrückt, die Anerkennung von Vielfalt in der Gesellschaft und ein Bewusstsein dafür, dass alle Personen, unabhängig von Geschlecht oder auch anderen Vielfaltsmerkmalen, gleiche Entwicklungschancen im Leben haben sollten.
Zu den negativen Aspekten
Allerdings habe ich auch viele für mich negative Erfahrungen mit dem Gendern gemacht:
- Sei es die Ausrichtung auf ausschließlich Gleichberechtigung und nicht auf Vielfalt in der Gesellschaft – und ich würde es teilweise eher Gleichmachung nennen, was für mich nicht der Realität entspricht.
- Sei es, dass Gendern zur Diskriminierung von anderen Personengruppen führt.
- Sei es das regelrecht „sklavische“ Gendern ohne Reflexion, dessen was durch Sprache in dem Moment ausgedrückt wird und ob dies noch den Fokus auf die Anerkennung der Vielfalt hat.
- Sei es ein sich Verstecken hinter einer nicht genderkonformen Sprache, um andere Themen und Probleme zu überdecken – es wird schnell nicht über Textinhalte, sondern das richtige Gendern gesprochen und geurteilt.
Für mich liegt der Konflikt also darin, dass mein Fokus auf der Anerkennung von Vielfalt in der Gesellschaft liegt, dies jedoch häufig sprachlich beim Gendern keinen Ausdruck bzw. keine Berücksichtigung mehr findet.
Ich finde Gendern ist ein sehr sensibles Thema, das deutlich weiter reicht, als nur der reine Sprachgebrauch, der durchs Gendern auch nicht immer einfacher wird, und möchte jedem empfehlen, sich regelmäßig selbst damit auseinander zu setzen:
- Was für einen selbst eigentlich der Kern des Genderns ist?
- Und wie man dies für sich selbst in guter Weise leben kann.
Oliver
Mit dem Konzept des Genderns bin ich, soweit ich mich erinnere, das erste Mal in den 8er Jahren an der Uni in Kontakt gekommen. Und auch wenn ich den Sinnzusammenhang verstehen konnte – für mich gehörte das irgendwie zu einer archaischen Vergangenheit. Seltsamerweise. Mein Elternhaus war “klassisch”: Vater Beamter, Mutter Hausfrau, zwei Kinder – ein Junge, ein Mädchen – klare Rollenverteilung der 60er.
Ich kann mich nicht daran erinnern wahrgenommen zu haben, dass an meiner Schule – zumindest in meinem Umfeld – aufgrund von Geschlecht oder Landeszugehörigkeit jemand bevorteilt oder benachteiligt wurde. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Ausgrenzung gab – aber eben eher wegen Beliebtheit, Klamotten, Überzeugungen oder Wesensarten. Mag natürlich sein, dass ich da etwas verdränge – für mich war das aber so.
Das hat sich später leider verändert, und leider habe ich heute sogar das Gefühl, dass viele Menschen bei diesem Thema im Rückwärtsgang unterwegs sind – und das nicht nur Männer. Aber das ist (vielleicht) ein anderes Thema.
Warum also Gendern? Sprachlich manifestieren, dass es da einen Unterschied gibt?
Hier die für mich wichtigsten Gedanken zu dem Thema:
PRO
Die deutsche Sprache ernst nehmen
Sagt oder schreibt man “Mitarbeiter”, sind es laut Duden eben nur Männer:
Quelle: Duden online
Gleichberechtigung
Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Warum also das eine Geschlecht sprachlich häufiger nutzen?
Differenzierung
Frauen und Männer sind unterschiedlich – und das ist gut so.
Die Sensibilität für das Thema erhöhen
Menschen in der tagtäglichen Kommunikation daran erinnern, dass bislang eingeübte Rollenverständnisse nicht richtig – und nicht mehr gewollt sind.
Kontra
Gleichberechtigung
Warum sollen wir sprachlich auf Unterschiede hinweisen, wenn wir Männer und Frauen als gleichberechtigt, verstehen? Wenn unsere Kinder – und auch wir – tagtäglich einüben, dass z.B. eben “Mitarbeiter” alle Geschlechter umfasst, entsteht ein anderes Verständnis für das Wort. Es gibt eben Mitarbeiter – kleine, große, muskulöse, weniger muskulöse, blasse und gebräunte …
Differenzierung
Eine sprachliche Differenzierung sollte eben nur für im jeweiligen Kontext tatsächlich wichtige Merkmale genutzt werden. Da wird es sicherlich Situationen geben, in denen eine Differenzierung zwischen Frauen und Männern sinnvoll sein kann. Zumeist ist es aber doch eher wichtig, bestimmte Eigenschaften einer Person – oder Personengruppe zu benennen. Im Beispiel bleibend: Mitarbeiter eben – aber vielleicht Mitarbeiter im Lager, in der Geschäftsleitung, im Controlling.
Die Sensibilität für das Thema verringern
Es ist schon aufwendig, konsequent zu gendern. Und das führt schnell zu genervter Ablehnung und schnell zu einer Verallgemeinerung: “Dieses dämliche Gegendere! Wer braucht das denn? Hält nur auf, macht Arbeit, bringt doch eh nix!”. Also wird das Gegenteil dessen erzeugt, was doch eigentlich das Ziel ist.
Und jetzt?
Bislang habe ich für mich keine eindeutige Lösung gefunden. Im Zweifel steht für mich aber das Thema Sensibilisieren im Vordergrund – sich selbst und andere immer wieder daran zu erinnern, dass wir Entscheidungen für unser Zusammenleben getroffen haben: Dass wir anderen Menschen unvoreingenommen und mit Respekt und Neugier begegnen. Das wir jeden einzelnen Menschen wahrnehmen, niemanden vergessen, Vielfalt begrüßen – nicht nur was Mann und Frau angeht.
Vivien
Ich persönlich fand es am Anfang schwer da eine 100%ige Stellungnahme abzugeben. Dies hat sich nach Reflexion und Recherche etwas geändert.
Aus meinen persönlichen Erfahrungen und dem gesellschaftlichen Wandel, finde ich eine Veränderung (welche die richtige ist, ist die Frage) jedoch für sehr sinnvoll. Allein der Dialog, die Diskussion und das Ausprobieren – „Was könnte passen oder auch eher nicht?“ – all dies bringt das Thema in den Vordergrund (ob positiv oder negativ), jedoch braucht jeder Wandel und jede Veränderung einen Anfang. Und eine Veränderung oder eine Anpassung ist in diesem Falle, glaube ich, angebracht. Da wir leider keine neue Sprache von Grund auf erfinden können, wo jederzeit alle Menschen inkludiert sind, müssen andere Herangehensweisen ran.
Für die schwedische Sprache wurde mit „hen“ ein geschlechtsneutrales Personalpronomen „es“ neu eingeführt (in den 1960ern erfunden, aber erst 2015 ins Wörterbuch übernommen). Warum sollten Sprachwissenschaftler und Germanisten dazu nicht im Deutschen in der Lage sein? In anderen Sprachen ist dies sogar normal.
Das Beispiel, einen gerichtlichen Beschluss nur in der weiblichen Form zu schreiben, wurde abgelehnt, da man denken könnte, es gelte nur für Frauen (Paradox in sich?).
Das Argument, dass Frauen in den männlichen Bezeichnungen mitgemeint sind, zeigt auf, dass (wir ‚Männer‘) ja auch an die Frau mitdenken. Aber da ist wieder der Punkt, dass man doch an die anderen Geschlechter mitdenkt, aber nicht explizit ausspricht, weil:
- sieht nicht schön aus
- ist ja logisch, dass man alle meint
- wir haben andere Probleme zu besprechen
- etc.
Dann frage ich mich, seit wann sieht ein Wort schön aus? Nur weil ein -in, /in oder *in dran geschrieben wird, sieht es auf einmal doof aus? Warum fühlt man sich von einer Schreibform angegriffen?
Wenn man alle meint mit einer Sprache, warum fühlen sich viele dann nicht angesprochen? Woher kommt der Umbruch dann?
Seit wann kann man Probleme
1. gewichten, die mehr als 50% der Gesellschaft betreffen?
Und 2. warum wird überhaupt in Frage gestellt, ob dies wichtig genug ist?
Sprache verändert auch das Denken. Ich bin der Meinung, wenn du mich meinst, dann sprich mich doch auch einfach an. Denn nur so kann der Grundgedanke der trennenden Sprache aufgebrochen und der Horizont erweitert werden. So können wir als Vorbild vorangehen.
Ein Zitat zum Schluss
Die männliche Form markiert „Männer als Norm“, die weibliche Form kodiert „Frauen als Abweichung“
~ Goethe Institut: „Wie „Gender“ darf die Sprache werden?
So wollen wir es ab jetzt halten
Im Team haben wir uns jetzt dazu entschieden eine Art “gemäßigtes Gendern” zu nutzen: Wo immer möglich nutzen wir angepasste Begriff-Variationen – in unserem Beispiel wird aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern “Mitarbeitende”. Wenn wir, zum Beispiel Frauen und Männer gezielt ansprechen wollen, tun wir das eben genau so: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Behelfslösungen wie *innen, :innen, usw. möchten wir nicht nutzen.
„Diversity“ betrachten wir für uns übrigens als die angestrebte natürliche Haltung.
So viel von uns. Wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn Ihr uns Feedback, eigene Gedanken und Wünsche zu diesem Thema mitteilt – hier im Blog oder auch gerne als eine persönliche Nachricht an uns.
Links zum Thema
Goethe Institut: „Wie „Gender“ darf die Sprache werden?
Schweizer Bundeskanzlei: Leitfaden geschlechtergerechte Sprache